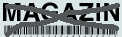Aus der Abderitengeschichte
Da nun überdies die Musik vollkommen nach dem Sinn des Dichters, und also das alles war, was die Musik des Nomophylar Gryllus – nicht war; da sie immer gerad aufs Herz wirkte, und ungeachtet der größten Einfalt und Singbarkeit doch immer neu und überraschend war; so brachte alles dies, mit der Lebhaftigkeit und Wahrheit der Deklamation und Pantomine, und mit der Schönheit der Stimmen und des Vortrags, einen Grad von Täuschung bei den guten Abderiten hervor, wie sie noch in keinem Schauspiel erfahren hatten. Sie vergaßen gänzlich, daß sie in ihrem Nationaltheater saßen, glaubten unvermerkt mitten in der wirklichen Scene der Handlung zu sein, nahmen Antheil an dem Glück und Unglück der handelnden Personen, als ob es ihre nächsten Blutsfreunde gewesen wären, betrübten und ängstigten sich, hofften und fürchteten, liebten und haßten, weinten und lachten, wie es dem Zauberer, unter dessen Gewalt sie waren, gefiel, – kurz, die Andromeda wirkte so außerordentlich auf sie, daß Euripides sebst gestand, noch niemals des Schauspiels einer so vollkommenen Empfindsamkeit genossen zu haben, (…)
Uebrigens macht der Verfasser dieser Geschichte hier die Anmerkung: Die Große Disposition der Abderiten, sich von den Künsten der Einbildungskraft und der Nachahmung täuschen zu lassen, sei eben nicht das, was er am wenigsten an ihnen liebe. Er mag dazu wohl seine besonderen Ursachen gehabt haben.
In der That haben Dichter, Tonkünstler, Maler einem aufgeklärten und verfeinerten Publikum gegenüber schlimmes Spiel; und gerade die eingebildeten Kenner, die unter einem solchen Publikum immer den größten Haufen ausmachen, sind am schwersten zu befriedigen. Anstatt der Einwirkung still zu halten, thut man alles, was man kann, um sie zu verhindern. Anstatt zu genießen, was da ist, raisonnirt man darüber, was da sein könnte. Anstatt sich zur Illusion zu bequemen, wo die Vernichtung des Zaubers zu nichts dienen kann, als uns eines Vergnügens zu berauben, setzt man, ich weiß nicht, welche kindische Ehre darein, den Philosophen zur Unzeit zu machen; zwingt sich zu lachen, wo Leute, die sich ihrem natürlichen Gefühl überlassen, Thränen im Auge haben, und, wo diese lachen, die Nase zu rümpfen, um sich das Ansehen zu geben, als ob man zu stark oder zu fein oder zu gelehrt sei, um sich von so was aus seinem Gleichgewicht setzen zu lassen. – (…)
Als der Vorhang gefallen war, sahen die Abderiten noch immer mit offnem Aug und Munde nach dem Schauplatz hin; und so groß war ihre Verzückung, daß sie nicht nur ihrer gewöhnlichen Frage: wie hat Ihnen das Stück gefallen? vergaßen, sondern sogar des Klatschens vergessen haben würden, wenn Salabanda und Onolaus (die bei der allgemeinen Stille am ersten wieder zu sich selbst kamen) nicht eilends diesem Mangel abgeholfen und dadurch ihren Mitbürgern erspart hätten, gerade zum ersten Male, wo sie wirklich Ursache dazu hatten, nicht geklatscht zu haben. Aber dafür brachten sie auch das Versäumte mit Wucher ein. Denn sobald der Anfang gemacht war, wurde so laut und lange geklatscht, bis kein Mensch mehr seine Hände fühlte. Diejenigen, die nicht mehr konnten, pausierten einen Augenblick, und fingen dann wieder desto stärker an, bis sie von Anderen, die inzwischen ausgeruht, wieder abgelöst wurden. Es blieb nicht bei diesem lärmenden Ausbruch ihres Beifalls. Die guten Abderiten waren so voll von dem, was sie gehört und gesehen hatten, daß sie sich genöthigt fanden, ihrer Ueberfüllung noch auf andere Weise Luft zu machen. Verschiedene blieben im Nachhausegehen auf öffentlicher Straße stehen und deklamierten überlaut die Stellen des Stücks, wovon sie am stärksten gerührt worden waren. Andere, bei denen die Leidenschaft so hoch gestiegen war, daß sie singen mußten, fingen zu singen an, und wiederholten, wohl oder übel, was sie von den schönsten Arien im Gedächtnis behalten. Unvermerkt wurde, wie es bei solchen Gelegenheiten zu gehen pflegt, der Paroxysmus allgemein; eine Fee schien ihren Stab über Abdera ausgereckt und alle seine Einwohner in Komödianten und Sänger verwandelt zu haben. Alles, was Odem hatte, sprach, sang, trällerte, leierte und pfiff, wachend und schlafend, viele Tage lang nichts als Stellen aus der Andromeda des Euripides. Wo man hinkam, hörte man die große Arie – O du, der Götter und der Menschen Herrscher, Amor u.s.w. – und so wurde so lange gesungen, bis von der ursprünglichen Melodie gar nichts mehr war, und die Handwerksburschen, zu denen sie endlich herabsank, sie bei Nacht auf der Straße nach eigener Melodie brüllten.
CHRISTOPH MARTIN WIELAND