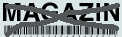Karl Rauschenbach
Ermüdungsrisse im Gebäude – Über einige Protest– und Aufstandserscheinungen der Jahre 2005 bis 2011
Europa ist seit neuerem wieder größeren sozialen Zerwürfnissen ausgesetzt. Nachdem man sich nach der Erosion des Ostblocks als strahlender Sieger zu feiern versuchte, die Demokratie als segensreiche Staatsform mit Zukunft erschien, kommt nun die Ernüchterung. Wir erleben eine Krise der Weltwirtschaft, und das zum Anlass genommen, versuchen sämtliche europäische Regime nun verschärft, ihre Staatswesen und ihr Menschenmaterial den neuen Anordnungen der globalen Wirtschaftsordnung anzupassen, und sei es nur, größere Teile an eine neue Armut zu gewöhnen. Die Polizei bekommt neue Befugnisse, die Gewerkschaften sollen Ruhe geben. Für den Fall von größeren Streikwellen gegen die Beschneidung der Haushalte etwa Spaniens, Portugals, Italiens oder Griechenlands soll EU-Kommissionschef Barosso in einem Gespräch mit dem damaligen Chef des europäischen Gewerkschaftsbundes lapidar gedroht haben: „Wenn sie diese Sparpakete nicht durchsetzen, könnten diese Länder in der demokratischen Gestaltung, in der wir sie bisher kennen, verschwinden. Sie haben keine Wahl, das ist alles.“ Und während die europäische Peripherie für ihr lasterhaftes Verhalten gescholten wird, kürzen auch die Zentren ihre Staatshaushalte, reformieren ihre Sozial- und Arbeitsgesetzgebung. Barosso hat recht, es gibt keine Wahl, und so geraten Staatschefs in Bedrängnis, wenn sie sich nicht den Diktaten des Paris-Berliner Zentrums fügen, erste „freiwillige“ Rücktritte und Regierungsumbildungen finden statt, die wesentlich auch politische Währungsunion steht zur Disposition, mindestens die Mitgliedschaft einiger Länder. Europa befindet sich in einer Demokratiekrise.
Entsprechend ächzt das gesellschaftliche Gefüge. Studenten, Schüler, Unterklasse, Mittelklasse, Arbeiter, Migranten: Alle treten in Erscheinung, mehrfach war der Notstand notwendig, häufig Massenfestnahmen, Gefängnisstrafen, große Polizeieinsätze. Sowohl die schweren Krawalle und Plünderungen im August 2011 in Großbritannien, denen dieses Buch gewidmet ist, und verwandte Ereignisse in den Jahren zuvor in Frankreich oder Griechenland als auch die um sich greifenden friedlich-naiven Massenproteste mit ihren Camps und Platzbesetzungen sind nur vor dem Hintergrund der allgemeinen sozialen Unruhe zu sehen, daher sollen sie sämtlich im vorliegenden einleitenden Essay einer fragmentarischen Betrachtung unterzogen werden. All diese Phänomene sind in ihren verschiedenen Formen jedoch nicht nur Teil der benannten allgemeinen Unruhe, sondern markieren ebenso die grundsätzliche Spaltung sämtlicher Sozialbewegungen der gegenwärtigen Gesellschaftsordnung. Der alte Gegensatz zwischen Sozialreform und Revolution erscheint nunmehr als Gegensatz von Protestcamp und Riot. Die klassischen reformistischen Studenten- und Arbeiterproteste beginnen selbst in diese beiden Pole zu zerfallen, sobald klar gemacht wird, dass man auf sie keine Rücksicht nimmt und ihre Stimme nichts gilt. Beide Extreme treten dabei zunächst unmittelbar auseinander. Auf der einen Seite hat man den offiziell erwünschten Unmut, eine Art politische Massennörgelei, auf die man sich berufen kann, wenn man Reformen durchführt. Vor allem aber bestätigen solche Bewegungen jede Politik und jede Ökonomie, ganz einfach, indem sie kollektiv ihren Willen zur Schau stellen, sicher keinen gefährlichen Gedanken zu äußern und noch weniger eine gefährliche Praxis. Sollte eine Minderheit dennoch einen gewissen Trubel veranstalten, so kann man das bei Bedarf leicht beiseiteschieben. Auf der anderen Seite die abrupte Negation der Gesellschaft, die staatliche Ordnung wird kurz angekratzt, die Eigentumsordnung gilt nicht mehr, alles steht zur Disposition. Dabei wird kein Ausweg aufgezeigt, und nachher geht der Staat gestärkt aus der Sache hervor, indem er verkündet, der alleinige Garant gegen die chaotischen Impulse der Gesellschaft zu sein. Es werden hier aber trotzdem Macht und Herrschaft sichtbar, die Gesellschaft erscheint kurz als das, was sie ist. Die Harmonie entpuppt sich im Zerplatzen als gehaltene Spannung, rohe Widersprüche treten hervor.
Allerdings können diejenigen, die eine grundsätzliche Umwälzung der kapitalistischen Produktionsweise anstreben, einen kühlen Kopf bewahren. Einerseits scheint alles zwar recht turbulent zu sein, aber andererseits öffnen die Geschäfte auch nach heftigen Ausschreitungen schon bald wieder. Streikbewegungen verlaufen im Sand, wenn überhaupt, nimmt man den Streikenden einige Krumen weniger weg oder verschiebt die Reform; mehr wollen sie in der Regel auch nicht. Noch weniger stören die massenhaften Platzbesetzungen. Alle gegenwärtigen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen teilen, dass sie sich nicht weiter für die Produktion dieser Welt interessieren, die sich damit stets von vornherein als Sieger weiß. Die beiden Pole friedlicher Protest und gewaltsamer Riot fallen darin unmittelbar zusammen. Eine grundsätzliche revolutionäre Bewegung, die den Produktionsprozess auf die Bedürfnisse der Menschen bezieht und keine verselbständigten Vermittlungen wie Profit oder Lohnarbeit zwischen die Produkte und die Produzenten schiebt, muss erst begründet werden, und das fängt in deutlich kleineren Kreisen an, die sich nicht einmal notwendig mit den oben angeführten Protesten überschneiden müssen. Was die hier behandelte wirkliche Bewegung angeht, so muss man sich über sie klar werden, ihre radikalen wie reaktionären Momente kennen, und seien sie auch nur embryonal. Die allgemeine Entwicklung könnte noch jeden Aspekt ins Zentrum spülen. Positiv betrachtet, gibt es innerhalb der größeren friedlichen oder gewaltsamen Proteste noch kaum Sehnsucht nach einem anderen Zustand, sondern im besseren Fall einen nihilistischen Hass auf alle bestehenden Formen, im durchschnittlicheren Fall handelt es sich einfach um eine überflüssige Massenansammlung. Möglich, dass irgendwelche Kreise es sogar schaffen könnten, irgendwelche radikalen Ideen zu verbreiten, aber das wird in jedem Fall eine Negation der üblichen Bewegungen beinhalten, die dann sicher nicht so weiter machen können wird wie bislang. Aber solche Kreise müssten sich erst für sich selbst ausbilden, sich finden und in der einen oder anderen Weise der Welt negativ gegenüberstehen, aus dieser Negativität ihre Kraft beziehen, um dann eventuell auch auf Teile der größeren Protestphänomene einen guten Einfluss auszuüben.
Die verschiedenen Proteste der vergangenen Jahre blieben in ihren Zielen und Formen äußerst bescheiden, defensiv. Sie haben sich einander abgelöst, aber selten die Hand gereicht. Es wäre falsch, diese Ereignisse getrennt voneinander zu denken, wenn sie auch weitgehend getrennt sind. Oft gibt es zwischen der einen und der anderen Erscheinung einen untergründigen Zusammenhang, und wenn er fehlt, so muss er hergestellt werden. Ein revolutionärer Prozess – so er denn überhaupt in Gang kommt – muss durch rohe Widersprüche hindurch. Die verschiedenen Momente einer nur spekulativ erzeugbaren „Bewegung“ haben unmittelbar nichts oder nur wenig miteinander gemein, stehen sich in Wahrheit oft genug feindlich gegenüber, wenn sie sich überhaupt treffen. Revolutionär ist in der Regel an ihnen erstmal gar nichts. Es kommt dabei aber alles auf die Herausarbeitung der konkreten Entwicklungen, Verwicklungen und Widersprüche an, und dafür fehlt es leider noch an einer wirkungsvollen Gegenpresse und überhaupt an einem Netz guter Beobachter, als die offizielle, demokratische Desinformation nichts mit diesen Phänomenen anzufangen weiß, es bei Strafe ihres Untergangs auch nicht darf. Interessant wurde es dabei immer, wenn verschiedene Proteste sich im Ansatz überlappten, es zu Gleichzeitigkeiten in der Ungleichzeitigkeit kommt. Vielleicht kommt vieles darauf an, dass sich die Ereignisse miteinander konkret reiben, neue Spaltungen verursachen, insgesamt die Sachlage klären und so die Voraussetzung für allerlei neue Mischungen ergeben.
I. Frankreich
Die jüngeren sozialen Unruhen Frankreichs begannen im November 2005 in den Vorstädten. Man kann durchaus sagen, dass das Land seither nicht zu brennen aufgehört hat. Insbesondere wirft dieses Ereignis einen Schatten auf alle folgenden Proteste; die Aufstände der männlichen, migrantischen Jugend in den französischen Vorstädten waren völlig nihilistisch. Anders als bei den jüngsten Unruhen in England wurde wenig geplündert, wahrscheinlich einfach, weil es in den Vorstädten nichts zu plündern gibt, dadurch gelangte der destruktive Teil in den Vordergrund. Es ging von vornherein nicht um eine Reform irgendeiner Institution. Die Zerstörung einer Schule macht alle Träume von sozialdemokratischen Lehrerinnen oder Sozialarbeitern zunichte. Die Kinder der Vorstädte wollen offensichtlich keine solche Schule, egal, ob reformiert, integrativ oder sonstwie. Analog ignoriert die Niederbrennung einer Teppichfabrik oder der örtlichen Boxschule alle Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Man erwartet insbesondere nichts vom Staat, den man nur als Polizisten kennt. Polizisten waren dann auch eines der Hauptziele dieser Unruhen, die sich an einem Polizeimord entzündeten. Ansonsten hielt man sich an den Autos schadlos, diesen im Überfluss produzierten Dingen.
Dieser Nihilismus prägte untergründig auch die im Jahr darauf folgenden Proteste der Studenten und Schüler. Diesen Angehörigen der Mittelschicht ging es sicher nicht unmittelbar um solche totale Negation, es gab politische Forderungen, Anbiederungen an die Medien. Während die Jungs aus den Vorstädten bei ihren Ausschreitungen zu Gewalt und Feuer greifen, neigen die Studenten zur Trillerpfeife. Allerdings sprang ein Teil des anarchischen Geistes der Vorstadtrevoluzzer auch auf die jungen Studenten über, als diese 2006 gegen die Flexibilisierung des Arbeitsmarktes demonstrierten und dabei eine Menge Gebäude besetzten, etwas Krawall veranstalteten, Bahnhöfe besetzten oder Straßen blockierten. Das brachte naturgemäß die Polizei auf den Plan, und so erlebten die zunächst leicht unterscheidbaren Bewegungen der Vorstadtjugendlichen und der Studenten genauso viele Festnahmen. Wenn man auch in der Regel die Bürgerkinder nicht so hart anfasst wie Unterschichtskinder, so bietet dieser gemeinsame Feind im Prinzip eine Grundlage der Vereinigung beider Gesellschaftsschichten, und tatsächlich stoppte die Polizei einige Züge aus den Vorstädten, just als diese wieder zu rumoren anfingen, um die Angelegenheit nicht eskalieren zu lassen. Aber man darf dabei unter keinen Umständen die wirklichen Spaltungen vernachlässigen, die durch die eherne Ordnung hervorgebracht werden: Die wohl bemerkenswertesten Vereinigungsversuche dieser beiden Sektoren der Gesellschaft bestanden darin, dass Banlieuekids einigen demokratischen Schülern ihre elektrischen Gadgets wegnahmen und es teilweise zu recht brutalen Angriffen kam. Das Geschrei war groß, aber es zeigt sich in diesem autoritären Verhalten auch, dass die Unterschichten die Lage recht gut verstehen: Sie verachten die Naivität derjenigen, die ihre dürftigen Privilegien verteidigen, ohne sich groß darum zu scheren, dass diese längst nicht für alle gelten können. Die unmittelbare Antwort einiger Vorstadtbewohner war also gewalttätig, aber es wird kein Mittel dagegen geben, als dass die Studenten wenigstens im Protest ihre Rolle ablegen und die stumme Gewalt der Gesellschaft wie die reale Gewalt ihrer Polizei wahrnehmen. Das würde allerdings zunächst das Entstehen radikalerer Elemente in solchen Studentenunruhen erfordern, die es nur im Ansatz gab und die sich in einigen schönen Wandparolen und in radikaleren Aktionen ausdrückten.
Dazu kommen noch die Proteste der Arbeiter, die genauso wie die der Studenten in ihren Zielsetzungen reformistisch sind. Das kann in Frankreich recht rabiate Formen annehmen, und so werden immer wieder Chefs gefangen genommen oder Werke blockiert. Solche Auseinandersetzungen finden immer wieder im Rahmen anderer Proteste statt, die Gewerkschaften beteiligten sich maßgeblich an den Studentenunruhen 2006, und während der politischen Bewegung gegen die Rentenreform wurden einige Raffinerien bestreikt, um deren Schließung zu verhindern. Die bloße Gleichzeitigkeit ließ im letzteren Fall eine Ahnung davon aufkommen, wie schnell man ein Land lahmlegen kann, sofern man das wünscht. Beide Bewegungen wurden daher auch von der Polizei angegriffen, wobei die Schnellgerichte monatelange Haftstrafen verhängten und es zu einem formellen Ausnahmezustand kam.
Man sieht in den jeweiligen Auseinandersetzungen, den Vorstadtunruhen, den Studentenprotesten und Arbeiterstreiks, die mehr oder weniger ausgeprägte Tendenz, den Lauf der aktuellen Ordnung zu unterbrechen, während gleichzeitig keinerlei allgemeine Idee davon entwickelt wurde, was an die Stelle dieser Ordnung treten solle. Das ist nicht besonders bemerkenswert, solange es sich wahlweise um vollständig destruktive, reformistische oder ökonomische Veranstaltungen gehandelt hätte. Allerdings war es gerade die fortgeschrittene Aktion, der sich überall äußernde Nihilismus, der dem Ganzen seinen Stempel aufdrückte. Es gibt kaum Sinn, die Verkehrsflüsse der Gesellschaft zu blockieren, wenn man eine politische Reform anstrebt oder ablehnt. Dafür gibt es schließlich offizielle Wege. Irgendeine Kommentatorin aus dem Zeitungssumpf hatte ganz recht, als sie schrieb: „Was ist das für eine Welt, in der es ‚soziale Spannungen‘ auslöst, wenn Arbeitnehmer unter 26 Jahren nicht schon mit dem ersten Job ins Sicherheitskorsett der Festanstellung von der Wiege bis zur Bahre fallen?“ Sie hat aber nur recht, wenn man den positiven Inhalt der Protestbewegungen ernst nimmt. Mit den Riots und Blockaden kommt zum Ausdruck, dass es um alles geht, selbst wenn die Akteure die schwerwiegenden Konsequenzen dieses Faktums selten bewusst ziehen wollen und daher weitgehend im Rahmen bleiben.
Dieser Widerspruch wurde später auch durch die französische anarcho-revolutionäre Schrift Der kommende Aufstand aufgegriffen. Dieses Pamphlet geht von den ersten Rissen im Sozialgefüge aus und benennt die Bedingungen, unter denen die spontanen Bewegungen zu einer handfesten Umsturzbewegung werden könnten: „Die Bewegung gegen die CPE zögerte nicht, Bahnhöfe, Ringstraßen, Fabriken, Autobahnen, Supermärkte und sogar Flughäfen zu blockieren. In Rennes bedurfte es nicht mehr als dreihundert Personen, um die Umgehungsstraße für eine Stunde lahmzulegen und vierzig Kilometer Stau zu verursachen.“ Dieses Verhalten spräche nun dafür, dass es um mehr geht als nur eine Erneuerung der alten Herrschaft, wenn auch noch in Form unbewusster, einfacher Negation derselben. „Alles zu blockieren ist der erste Reflex all dessen, was sich gegen die gegenwärtige Ordnung richtet.“ Sinn machen die destruktiven Blockaden, die Sabotage der Produktion und Verteilung nur, wenn man sich gleichzeitig daran macht, auch die freie Produktion zu organisieren: „Aber es kann nicht darum gehen, mehr zu blockieren, als es die Fähigkeit zur Versorgung und Kommunikation der Aufständischen, die tatsächliche Selbstorganisation der verschiedenen Kommunen erlaubt. Wie können wir uns ernähren, wenn alles lahmgelegt wird? Die Geschäfte plündern, wie dies in Argentinien gemacht wurde, hat seine Grenzen; so gewaltig die Konsumtempel auch sind, sie sind keine unerschöpfliche Vorratskammer.“ Man muss also die Produktion den Händen des Kapitals entreißen, zur kollektiven Produktion übergehen. Die Negation muss sich selbst negieren, konstruktiv werden: „Auf Dauer die Fähigkeit zu erlangen, sich seine grundlegende Versorgung selbst zu schaffen, bedingt also, sich die Mittel ihrer Produktion anzueignen.“ Die deutsche Rezeption hat dieser Schrift immer wieder eine Verklärung der aktuellen Proteste, insbesondere der Unruhen in den Vorstädten vorgeworfen, während diese klassische kommunistische Idee lieber ignoriert oder aber im Sinne einer primitiven Autarkie und Selbstversorgungsphantasie interpretiert wurde. In Frankreich verstand man die Sache besser: Die Schrift führte zu einer Polizeirazzia, und einige ihrer mutmaßlichen Autoren wurden eine Weile gefangen genommen. Tatsächlich könnte die Idee, „sich die Mittel der Produktion anzueignen“, eine Gefahr für die Ordnung werden, und so bewies der Staat einen guten Riecher für derlei Gedankenverbrechen, wenn auch seine Maßnahmen eher dazu führten, dass das Heft erst wirklich populär wurde.
II. Griechenland
Um Griechenland steht es besonders schlecht. In diesem Land wurde als erstes das Parlament weitgehend entmachtet, und nun bestimmt die aus EU-Bürokraten, Europäischer Zentralbank und Internationalem Währungsfonds bestehende Troika die Politik. Hier gibt es dementsprechend alle Formen des Protestes: Arbeiter, Unterklassen, Studenten, Schüler, Beamte, Bauern. Fast allen geht es an den Kragen, und fast alle stinken irgendwie dagegen an. Tatsächlich gibt es hier sogar Ansätze eines Boykotts der Warenform, indem kaum noch Tickets für den Nahverkehr verkauft werden. Aber in der Hauptsache gibt es eine gehörige Konfusion.
Der Ausgangspunkt der jüngeren Entwicklung waren dabei dreiwöchige Ausschreitungen im Dezember 2008. Man kann das mit den Unruhen der französischen Vorstädte vergleichen, die in Frankreich die Initialzündung weiterer Proteste darstellten. Im Unterschied zu Frankreich hockt in Griechenland eine starke anarchistische Szene, und von dieser ging der Aufstand aus. Interessant ist dabei erstens, dass sämtliche Spaltungen der Szene ausgesetzt wurden und alle Gruppen und Individuen aller Generationen dieser Richtung sofort auf die Straße gingen, einige Gebäude besetzten, um Anlaufpunkte zu haben, und zweitens, dass ziemlich sofort auch eine Menge Schüler, Studenten und Einwanderer ihrerseits zu einem Aufstand übergingen, so dass die an ihre absolute Isolation gewöhnte anarchistische Szene sich urplötzlich im Herzen einer allgemeinen Erhebung befand. Im Unterschied zu sämtlichen artverwandten Erscheinungen der jüngeren Vergangenheit bekam der Aufstand dadurch einen unmittelbar utopischen Charakter. Es wäre ein Unfug, ihn in toto als einen anarchistischen Aufstand zu bezeichnen – überhaupt braucht man die anarchistische Szene nicht überschätzen, aber immerhin kommt hier ein notwendiger Aspekt hinzu: Der Aufstand beginnt, Ideen hervorzutreiben. In Frankreich tauchte der revolutionäre Inhalt abgespalten in einem einzelnen Buch auf. In Griechenland haben die zahlreiche Akteure eine Stimme gefunden, man kann lesen, was sie wollten. Das ist wirklich eine Besonderheit dieser Dezemberunruhen.
Das Land kam seither nicht mehr zur Ruhe, zumal die Regierung durch den Staatsbankrott und den Druck einiger mächtiger Institutionen zum Sparen angehalten ist und die Bevölkerung dabei nicht stillhält. Allerdings muss man dabei betonen, dass der anarchistische Geist nur scheinbar auf die allgemeine Bewegung übersprang. Einerseits gab es eine Verallgemeinerung der Gewalt, indem zahllose Individuen die Taktik der Destruktion von den Anarchisten übernahmen, so dass diese selbst teilweise über das Ausmaß des angerichteten Chaos erschraken. Seither brennt Griechenland buchstäblich an allen Ecken und Enden. Das Parlament wurde beinahe durch aufgebrachte Arbeiter gestürmt, in einer ländlichen Region kam es wegen der geplanten Errichtung einer Mülldeponie zu bürgerkriegsähnlichen Situationen, ein Minister wurde blutig gehauen und dergleichen mehr. Aber es zeichnet sich dabei keinerlei Bild der Zukunft ab, es bleibt buchstäblich unklar, was die Sache eigentlich soll, welche grundsätzlichen Schritte zu unternommen seien etc. Darüber gibt es nicht den Ansatz einer gesellschaftlichen Debatte, und die Bewegung tritt auf der Stelle, während die griechische Gesellschaft weiter erodiert, Pogrome stattfinden, Ausländer ohne Papiere gejagt und interniert werden, die Obdachlosen- und Selbstmordrate steigt, die Leute aus den Städten aufs Land fliehen.
Unter den Anarchisten gibt es immerhin den Ansatz zu einer Reflexion einiger aufkommenden Fragen. Es existiert hier eine erste Sehnsucht, die Auseinandersetzung auf ein höheres Niveau zu heben. Dabei scheint sich die Szene selbst zu spalten, wenn sie auch nicht immer einen vernünftigen Begriff dieser Spaltung hat, die sich dadurch an falschen Widersprüchen auftut, etwa der Frage der Gewalt. Gerade ernsthafte Spaltungstendenzen können sich dabei auch als Vorteil entpuppen, weil sich in solchen Spaltungen wichtige inhaltliche Fragen klären können. A.G. Schwarz spricht in seinem in Wir sind ein Bild der Zukunft erschienen Aufsatz „Was Griechenland (aus meiner Sicht) für den Anarchismus bedeutet“ schematisch von einer Spaltung in nihilistische Anarchisten (anti-social anarchists), die auch gegen die Integration der großen Mehrheit in die herrschenden Verhältnisse angehen wollen, und Anarchisten, die versuchen, in der Gesellschaft selbst zu wirken, und das Problem in den Superstrukturen Wirtschaft und Staat zu erkennen glauben, denen die Gesellschaft untergeordnet ist (social anarchists). Vielfach neigen die Letzteren dazu, die Form über allen Inhalt zu stellen und dabei alle Widersprüche zu übersehen, man freut sich über jede Massenbewegung, hofft, diese würde sich radikalisieren. Dagegen formulierte eine inzwischen mindestens zu größeren Teilen von der Polizei ausgehobene, sicher nicht gesellschaftsfähige revolutionäre Gruppe sehr klar: „Es gibt überhaupt keine Beziehung zwischen dem maskierten Anarchisten, der Molotows wirft, weil er die Überreste ablehnt, die als Leben angeboten werden (die Kultur des Spektakels, den Wert des Geldes), und dem ‚wütenden‘ Angestellten, der demütigen Bewusstseins seinen Kopf kurz erhebt, sobald er eine Leere in seinem Geldbeutel spürt. Der Angestellte ist dieselbe Person, die zuvor noch, als er sich für ‚zufrieden‘ hielt, von den Unruhestiftern verärgert wurde. Da ist eine riesige Kluft zwischen den jeweiligen Werten, die keine Gewalt, keine Konfliktsituation überbrücken wird, solange es kein substanzielles Bewusstsein und keine Selbsterkenntnis gibt. In den Texten, Büchern, Pamphleten, Wandparolen, Plakaten sehen wir einen Beitrag in Richtung revolutionäres Bewusstsein. Das ist unsere theoretische Propaganda gegen ein System, das sterben muss. Und die Demonstrationen? Demonstrationen können auch beitragen, aber wir müssen sie von einer neuen Perspektive sehen.“ Es geht dabei darum, in die gegenwärtigen Zerwürfnisse Griechenlands zu intervenieren, also stärker mit radikalen Ideen präsent zu sein. Allerdings wird großer Wert auf die Negativität dieser Interventionen gelegt, die zu schwach sind, um der alten Welt wirklich etwas entgegenzusetzen, aber dabei immerhin den Reformismus und die Sozialnörgelei von vornherein beiseite lassen. Auf diesen beiden Wegen verlieren sich regelmäßig diejenigen, die versuchen, ihre „Inhalte“ breiter zu vermitteln. Dabei kommt nur heraus, dass sie außer ein paar Phrasen auch nichts anzubieten haben, und dementsprechend hohl wirken dann häufig ihre Aktionen. Der Inhalt des radikalen Flügels verbirgt sich dagegen in Negationen: Es geht nicht um mehr Geld, sondern um die Aneignung des wirklichen Lebens, um die Abschaffung der universalen Vermittlung über das Geld. Dass dies identisch mit der flächendeckenden, selbstbewussten Aneignung der Produktion sei, wird nicht explizit gesagt. Diese radikale Anspruchslosigkeit entspringt wohl der Schwäche. Dafür liegt den existenzialistischen Schreiben dieses Flügels oft ein erstaunlicher Realismus zugrunde: „Die Wirtschaftskrise in Griechenland und ihre Auswirkungen lassen bereits das Bild eines neuen gesellschaftlichen Kannibalismus aufscheinen. Die sozialen Explosionen, die plötzlich aus der Mehrheit der Arbeiter hervorbrechen, kümmern sich nur um ihre eigenen gewerkschaftlichen Geldforderungen. Oft führen die Proteste der einen Angestellten (streikende Lastwagenfahrer, die Blockade der Häfen durch die Hafenarbeiter usw.) sogar zu sozialem Missfallen unter anderen Angestellten. Selbstverständlich ändert sich die Szenerie häufig, und die, die gerade auf der Straße sind, um ihr privates Morgen einzuklagen, stehen gegen andere, die für ihre eigenen Forderungen streiken würden (Zum Beispiel LKW-Fahrer gegen die ländlichen Blockaden, Bürger gegen streikende öffentliche Angestellte, Eltern gegen streikende Lehrer usw.). All diese gesellschaftlichen Proteste lassen unsere Sprache und unser Bewusstsein verarmen, indem sie einen besseren Staat, einen besseren Job, eine bessere Erziehung, eine bessere Gesundheitsversorgung einklagen, aber sich niemals daran wagen, dass das Problem nicht einfach darin besteht, ob wir mehr oder weniger arm sind als gestern, sondern darin, dass wir in einer Weise leben, die uns nicht gehört.“
Diese Minderheitenkonflikte innerhalb der Anarchisten finden auch ihr Echo in den Straßenauseinandersetzungen selbst. Einerseits ruft der Abgeordnete der linken Partei SYRIZA im Parlament zum friedlichen Protest auf und beklagt sich über die „Strategie der Spannungen“ des Staates. Die Unterstellung ist dabei immer, dass extremistische Kräfte der herrschenden Ordnung extremistische Gegner derselben zum Anlass für verschiedene Repressionsmaßnahmen nehmen, etwas, das bei der gegenwärtigen Lage in Griechenland gar nicht überraschend wäre. Andererseits verteidigten die von der offiziellen kommunistischen Partei (KKE) kontrollierte Gewerkschaft PAME und ihr Anhang das Parlament gegen anrückende Demonstranten – unter diesen sicher viele Anarchisten irgendwo zwischen den beiden oben angeführten schematischen Polen sowie anderes unzufriedene Volk. Es kam so zu heftigen körperlichen Auseinandersetzungen beider Fraktionen. Teile der Bewegung unternahmen es dabei, gegen die Radikalen vorzugehen. Die Spaltung innerhalb der Anarchisten ist in dieser allgemeinen Spaltung der Protestbewegung aufgehoben. Die linken Parlamentarier, die alten Kommunisten und die von diesen kontrollierten Mitglieder stellen sich hinter die alte Gesellschaft, versuchen, den Zusammenbruch des Staates und die Diktatur zu verhindern, indem sie unmittelbar Polizeiaufgaben übernehmen. So will man der „Strategie der Spannung“ zuvorkommen, verschärft aber nicht zuletzt ebendiese Spannungen. Der wütendere Teil ist dagegen schon dadurch nihilistisch, indem er sich solchen politischen Gedanken von vornherein verweigert und die Sparmaßnahmen auch wider allen ökonomischen Verstand stoppen will. Das hätte unweigerlich den Staatsbankrott zur Folge, und tatsächlich muss sich der radikale Teil des Protestes und überhaupt die große Masse fragen lassen, was nach solch einem systematisch herbeigeführten Zusammenbruch eigentlich herauskommen solle – außer einer Diktatur. Diese wirkliche Frage geht aber bislang in den wechselseitigen Vorwürfen unter, und so beschimpft man sich als „Anarcho-Faschisten“ und „Stalinisten“. Derweil trat der amtierende Regierungschef auf Druck unter anderem Deutschlands zurück, nachdem er zunächst ein Referendum über die weiteren Sparmaßnahmen angekündigt und schnell wieder abgesagt hatte.
III. Ägypten
Just als mit der Sanierung der Staatshaushalte, der Krise der Wirtschaft und den ausbrechenden Unruhen auch der Demokratie eine ernste Krise drohte, rumorte es auch in Nordafrika, und einige der europäischen Bündnispartner gerieten in starke Bedrängnis. In Tunesien, und wichtiger, in Ägypten kam es zu Plünderungen, und jede Menge Polizeiwachen brannten – die Sache erinnerte zunächst an die Unruhen der französischen Vorstädte oder jetzt in London. Schließlich setzten sich in Ägypten auch noch die Arbeiter in Bewegung mit ihren über die kapitalistischen Möglichkeiten hinausgehenden innerkapitalistischen Forderungen. Es sah nicht gut für den Westen aus, und die Sache ist alles andere als überstanden, auch wenn es inzwischen einige Regierungswechsel gegeben hat und Wahlen abgehalten wurden. Die Rationalisierung dieser für den europäischen Westen eher bedrohlichen Entwicklung durch die hiesigen Autoritäten und ihre Sprachorgane wirft dabei ein interessantes Licht auf eine mögliche Rationalisierung der aktuellen gesellschaftlichen Konflikte in Europa.
Der Aufstand in den arabischen Regimes ist in all seinen Teilen mit den Unruhen Europas vergleichbar, und er wurde den hiesigen Gepflogenheiten vollständig entsprechend als Polizeiproblem gehandhabt. Die Sache drohte aber größere Kreise zu ziehen, also verriet der Westen scheinbar seine Bündnispartner und schloss sich dem Protest an. Plötzlich geriet die spektakuläre Besetzung des Tahrir-Platzes in Kairo in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses, und alle Welt schwärmte von einer friedlichen Facebook-Twitter-Revolution. Was stattfand, war eine Verwechslungskomödie sondergleichen. Es kann dabei gut sein, dass ein großer Teil des abstrakt unter der ägyptischen Fahne vereinigten Demonstrantenstadls tatsächlich irgendeine leere Idee von Demokratie im Kopf hatte und mangels Kreativität auf die populistische Parole „Mubarak muss weg“ verfiel, aber das wäre dann nur ein weiterer Aspekt dieser Verwechslungskomödie. Es gibt in Ägypten keine entwickelte politische, demokratische Bewegung, und zu glauben, diese könne jetzt plötzlich entstehen, nur weil ein korrupter Diktator weg ist, ist ebenso absurd, wie zu glauben, der Diktator sei von den friedlichen Volksmassen gestürzt worden, die den Ersatz für eine demokratische Kultur abgeben sollten.
Aber hierzulande waren sich alle sofort einig: Die Demokratie hat in Ägypten gesiegt. Eine friedliche Massendemonstration hatte es geschafft, einen Diktator zu stürzen. In Wirklichkeit passierte etwa das Gegenteil. Weit entfernt davon, von einer friedlichen Massenbewegung gestürzt worden zu sein, wurde Mubarak durch sein Militär abgesetzt – sicher in Absprache mit den wichtigsten Mächten. Das Militär behauptete, dabei im Einklang mit der demokratischen Bewegung zu handeln, für die Revolution zu stehen. Tatsächlich war das Regime unter Druck geraten, aber so sehr sie auch die kindlichen Phantasien unseres Feuilletons inspiriert hat, die Besetzung des Tahrir-Platzes war dafür nicht das ausschlaggebende Moment. Es hatte, wie gesagt, mit Ausschreitungen und Plünderungen begonnen, die die korrupte Polizei in starke Bedrängnis brachten, und dann kamen die Arbeiteraktionen hinzu. Es gibt in Ägypten eine lange Tradition illegaler Streiks. Der Aufstand vom Frühjahr 2011 hatte seinen Vorläufer in einer im Dezember 2006 in Mahalla losbrechenden Streikbewegung. Alle auf dem Tahrir-Platz bejubelten die Selbstorganisation: Kollektivierung der Nahrungsmittel, kostenfreie medizinische Versorgung wurde bereits in dieser Arbeiterbewegung populär. Den Tahrir-Platz hätte man auch bequem aussitzen können, irgendwann hätten die Leute Versorgungsengpässe bekommen, aber die neuerliche Streikbewegung bildete eine wirkliche Gefahr für die Stabilität der Herrschaft, und sofort übernahm das Militär die Macht. Die Leute auf dem Tahrir-Platz wurden nach Hause geschickt und die Streiks unter anderem im Staatssektor und am Suezkanal erst einmal erfolgreich zurückgedrängt. Die ersten Dekrete der neuen Staatsmacht riefen dazu auf, zu einem geordneten Alltag zurückzukehren und dabei vor allem: wieder zu arbeiten. Dementsprechend repetiert die neue Propaganda Ägyptens, Streiks seien „konterrevolutionär“; sie stehen unter Haftstrafen. Die Arbeiterunruhen lassen sich allerdings nicht völlig unterdrücken, sei es wegen der relativen Stärke der Gewerkschaftsbewegung oder wegen der Unzuverlässigkeit der Soldaten in den unteren Rängen. Tatsächlich handelt es sich also nicht um einen Konflikt zwischen Demokratie und Diktatur, sondern um einen andauernden sozialen Konflikt, wobei die Arbeiter selbst nicht revolutionär gesinnt sind und im Prinzip nur einige Reformen anstreben. Aber wie in Griechenland reicht das aus, um die Diktatur in der einen oder anderen Form notwendig zu machen. Die Maskerade auf dem Tahrir-Platz diente dabei einfach dazu, unter dem Deckmantel der demokratischen Revolution eine Konterrevolution durchzuführen, Islamisten inklusive. Die Herrschaft hat einfach eine kleine Rochade vollzogen, die Repression nicht nachgelassen. Wenn sich etwas geändert hat, so am ehesten im imperialistischem Gleichgewicht, als sofort iranische Kriegsschiffe den Suezkanal passieren durften. Vor diesem Hintergrund verwundert es kaum, dass bald die israelische Botschaft einem wütenden reaktionären Mob ausgesetzt wurde. Solche weltlichen Lügen brauchen den Antisemitismus oder eine artverwandte Ideologie, um sich gegen die allzu offensichtliche Wahrheit abzudichten.
Dieser Wahrheit muss sich auch Europa verweigern, welches selbst Schauplatz sozialer Aufstände ist, und so erdreistet es sich, den Sieg seiner Werte ausgerechnet in Nordafrika zu bejubeln. Alle waren besoffen von der Demokratie und das zu einem Zeitpunkt, an dem hier niemand mehr an sie glaubt und obwohl offensichtlich eine Militärdiktatur eingeführt worden war. Resultat dieses Neusprechs ist einfach die Verwirrung von Diktatur und Demokratie. Im Grunde ist es alles andere als neu. Die Regime des Ostens waren zusammengebrochen und heißen beinahe sämtlich seither Demokratie, die Diktaturen Südamerikas wurden in irgendeiner Form durch sogenannte Demokratien ersetzt. Doch wie das Geld in der Inflation verlor im Prozess dieses Wort seinen Inhalt. Die Sache wird heute im Wesentlichen auf irgendwelche lächerlichen Parlamentswahlen beschränkt, während republikanische Freiheiten kaum hoch im Kurs stehen. Indem man zunächst Diktaturen zu Demokratien machte, kann man auch in formellen Demokratien faktische Diktaturen einführen, ohne den Namen zu ändern, ja sogar, ohne unbedingt Wahlen abschaffen zu müssen. Der Ausnahmezustand wird bei Bedarf einfach trotzdem ausgerufen, Parlamente auf unbestimmte Zeit suspendiert, zumindest ihre Entscheidungsgewalt stark beschnitten etc. Es ist dies die Wirklichkeit in Europa, der sich jede Opposition stellen muss. Wir leben längst nicht mehr im Zeitalter der bürgerlich-republikanischen Demokratie, sondern in einer postfaschistischen Massendemokratie, in der die Wähler nur akklamieren. Ägypten hat gewählt, und gewonnen haben – Fluch der großen Zahl – die Islamisten, die sich vorerst mit dem Militär die Macht teilen werden, zum Verdruss derjenigen, die immer noch auf dem Tahrir-Platz gegen die Repression, die Diktatur oder die Frauenunterdrückung protestieren und dabei – nun legitimiert durch des Volkes in den Wahlen geäußerten Willen – erschossen werden wie eh und je.
IV. Weltweit friedliche Protestcamps – Plünderungen in Großbritannien
Die ideologischen Manöver anlässlich der Ereignisse in Nordafrika tragen erste Früchte. Indem man jede wirkliche Bewegung in Nordafrika ignorierte, entstand auch ein magisches Bewusstsein, so als ob eine Volksmenge ohne Ziele, Ideen, Konflikte, Versammlungen oder Räte und vor allem ohne eine intensive Auseinandersetzung eine Regierung stürzen kann. Jede Protestbewegung wird dabei auf „verständliche“ Unzufriedenheit und Passivität reduziert, während man gleichzeitig solche Bewegungen als Rechtfertigung anstehender Reformen und Umstrukturierungen nutzen kann. Dementsprechend kam es in Europa zu einer Welle von Pseudoprotesten. Spanien, das Land mit der arbeitslosen Jugend, erlebte seine eigenen Tahrir-Plätze. Überall im Land versammelten sich die Menschen zu einem unendlich langen Meeting und kamen dabei zu keinem Ergebnis. Überall war von der Debattierfreude auf solchen Veranstaltungen zu hören, aber es gibt aus diesem Spektrum nicht eine gute Idee, alles blieb im Rahmen des „Wir sind nicht gegen das System, das System ist gegen uns!“ Sie nennen sich die „Empörten“, sind aber eher die „Beleidigten“. In ihrer großen Masse will diese Bewegung unpolitisch sein. Der spanische Fußballdeserteur Poves hat eine dieser Bewegungen besucht: „Ich ging dorthin, um mich zu informieren, was sie wollen, aber ich teile nichts mit ihnen. Es ist eine Bewegung, formiert durch die Medien, um die vorhandene soziale Unzufriedenheit zu kanalisieren, sowie zu verhindern, dass dieser Funke der Unzufriedenheit für das System zu gefährlich und unkontrollierbar wird.“ Die Campbewegung griff auf New York und dann in die ganze Welt über, wurde zu Occupy Wall Street. Ziel der Proteste sind die Börsen, also genau die Orte, die am weitesten von der Problemlösung entfernt sind. An der Börse werden die Probleme der Produktion genauso wenig gelöst wie im Parlament die politischen Probleme. Die ganze Sache ist pure Augenwischerei, läuft aber unter dem Namen „Revolution“.
Mitten in das läppische und von Politikern wie Medien mindestens tief verstandene Protestzeugs platzte dann die wirkliche Welt herein: London brannte lichterloh. Gebäude, Polizeiautos, ganze Lagerhallen mit unendlich viel elektronischem Zeugs drin. Es kam zu massiven und organisierten Plünderungen und einem gewissen Grauen in der Pressewelt: „Immer wieder taucht die Frage auf: Warum haben die das getan? Niemand kennt die Antwort. Weder in Tottenham noch in den Redaktionen der nationalen Medien oder bei den Spitzen von Politik und Polizei herrscht Klarheit, wer überhaupt hinter den Gewaltausbrüchen in Tottenham und in weiteren Quartieren steht, die am Sonntag und Montag folgten, und was die Beweggründe sind. Manche Medien nennen die Täter Anarchisten, doch das belegt lediglich das Fehlen passender Beschreibungen. Es gibt kein politisches Programm, keine Pamphlete, keine Forderungen. Obschon bis Montagmorgen schon über 160 Personen festgenommen wurden, ist unklar geblieben, wer diese Gewalttäter eigentlich sind. Sie sind zumeist jung, tragen schwarze oder graue Kapuzenpullover, organisieren sich über Internet und Mobiltelefon. Doch was sagt das aus?“ Wenn in der Hölle kein Platz mehr ist, sendet Satan seine Toten auf die Erde zurück. Der Bodensatz quillt hervor, die Unterschicht feiert saturnische Feste, zum Leidwesen derjenigen, die stets die Augen verschließen und lieber Rezepte von Jamie Oliver kochen.
Das ist die eingangs erwähnte wirkliche Spaltung der Bewegung, das die sind wirklich modernen Momente derselben. Ausschreitungen, Zerstörung, Plünderung auf der einen Seite und konfuse Massenversammlung auf der anderen. Anders als bei den Studenten- oder Arbeiterprotesten wird hier in beiden Fällen auf jede Forderung verzichtet, alles bleibt unbestimmt und damit im Prinzip voller Möglichkeiten und gleichzeitig ohne jede Möglichkeit. Wie anfangs gesagt: Beide Seiten kommen ohne die Sphäre der Produktion aus und ergreifen so nicht wirklich das Alltagsleben. Ansonsten sind diese beiden Pole selten in ihrer Reinform zu finden. In die reformistischen Studenten- und Arbeiterunruhen mischen sowohl Ausschreitungen wie spontane Versammlungen hinein. Es gibt dort Nihilismus und Demokratie. Dort gäbe es auch Leute, die im Leben stehen und die eine grundumstürzende Revolution ins Werk setzen könnten, aber eben auch den lähmenden Reformismus und das Kleben an den bisherigen Verhältnissen. Die beiden letztgenannten Charakteristika treffen wiederum die Phänomene der nihilistischen Ausschreitungen und der nur empörten Massenproteste als solche kaum.
Keine der genannten Bewegungen wird sich radikalisieren. Radikalisieren setzt immer voraus, dass es im Prinzip in die richtige Richtung geht, während in Wirklichkeit alles auf die bestimmte Negation ankommt. Man kann auch bestehenden, langweiligen Protest partiell negieren, und gerade in England gelang es einigen Anarchisten während eines Protestmarsches gegen Kürzungen im sogenannten Bildungsbereich, die Zentrale einer der Parteien aufzubrechen und so endlich für die nötige Stimmung zu sorgen. Tatsächlich ging seither ein Hauch von Anarchie durch die britische Studentenbewegung, und einige der kleineren Riots könnten umgekehrt die Unterschicht animiert haben, den Spuk der Studenten im großen Maßstab zu wiederholen. Es ist jedoch recht unwichtig, ob die konkreten Träger einer Bewegung sich fortentwickeln. Neue Ideen können auch von anderen Menschen erfasst werden, die gestern noch im Trott des Alltags hingen. Ganz allgemein gesprochen, kommt vieles darauf an, dass die Auseinandersetzungen auf einer anderen Ebene geführt werden. Dabei werden sicher nicht zuerst sämtliche Fabriken und Werkstätten besetzt. Aber man könnte durchaus auch dazu übergehen, einzelne Aspekte der Warenwelt wenigstens zeitweise zu suspendieren, indem man an einigen Stellen einzelne Dienstleistungen kollektiviert: Handwerker, Nahverkehr, medizinische Versorgung … Das setzt aber voraus, dass die Revolte auch die Privatsphäre ergreift, neue Formen der Kollektivität ausprobiert, überhaupt alle bisherigen Formen des Beisammenseins, die jeweiligen stereotypen Verhaltensmuster infrage gestellt werden – ein wichtiges Ferment bei allen Auseinandersetzungen, die etwas taugen sollen. Aber das wäre eine vollständig neue Massenbewegung, die ihre Widersprüche austrägt und dabei eine innere Bestimmung erreicht. Ein Verein sich assoziierender Individuen, der zu einem gemeinsamen Denken und Handeln kommt. Das alles ist nicht unmittelbar in den gegenwärtigen Entwicklungen enthalten, und man braucht sich auch nicht unbedingt viel von diesen erwarten.
Trotzdem verweisen die Plünderungen Britanniens stärker auf den Ernst der Auseinandersetzungen, auf die tiefen gesellschaftlichen Probleme dieser Zivilisation. Es geht dabei nicht nur um die Frage der Unterklassen allein oder um den Rassismus. Tatsächlich waren es die Unterklassen, die revoltierten, und tatsächlich gab es viele Immigranten allerlei Nationen darunter. Indem sich die Armen die ihnen sonst schwer zugänglichen, aber nichtsdestotrotz begehrten Waren nahmen, offenbarten sie auch auf verrückte Weise den ganzen Unsinn des Konsums; indem Sony brannte, offenbarten sie den Unsinn der Überflussproduktion bei gleichzeitig gesellschaftlich hergestellter Knappheit. Indem kleine Läden in Rauch aufgingen wurde der Unsinn dieser speziellen Barbarei kenntlich, indem alle moralisch die kleinen Läden verteidigten, diese Orte unendlicher, überflüssiger Plackerei. Wenn man so will, wurde noch in der viel beklagten Rohheit vieler Rioter deutlich, wie sehr die Welt inklusive der prekären Familiensozialisation einer Revision bedarf, obwohl viele Szenen dieser Tage auch vom Lächeln der Beteiligten geprägt gewesen sein dürften, die sich in großer Zahl in Supermärkten und anderen Geschäften bedienten, ohne dass eine Kassiererin eigens dafür zum Geldeintreiben abgestellt werden musste. Manchmal fällt von abseitigen Phänomenen her Licht aufs Ganze. Chelsea Ives, die achtzehnjährige Vorzeige-Athletin und offizielle Botschafterin der Olympischen Spiele in London 2012, wurde festgenommen, weil sie sich an den Plünderungen beteiligt und ein Polizeiauto mit einem schweren Gegenstand zertrümmert hatte. Zertrümmert hat sie wahrscheinlich auch ihre Karriere und damit die Früchte ihrer aufgebrachten Mühe und Disziplin. Es sei der „beste Tag aller Zeiten“ gewesen. In solchen Situationen des bewusst herbeigeführten Zusammenbruchs der gewöhnlichen Beziehungen wird oft deutlich, wie sehr diese aufs Gemüt drücken, die Luft zum Atmen nehmen. Die wirkliche Repression richtet sich daher gegen die englischen Aufrührer. 16.000 Bullen sorgten für Sicherheit, die Gerichte arbeiteten die ganze Nacht, um zahllose Plünderer zu Haftstrafen zu verurteilen. Es ist eine deutliche Warnung an all diejenigen, die in irgendeinem Segment der Gesellschaft Chaos stiften wollen. Es gibt in England schließlich auch unzufriedene Schüler, Studenten und Arbeiter. Außerdem steht Olympia vor der Tür.
Dagegen leiden die demokratischen Massenbewegungen an ihrer Abstraktion. Gerade erst aus Facebook materialisiert, stellen sie überhaupt keine Probleme und damit jedes Problem. Sie meinen, 99 Prozent der Bevölkerung zu repräsentieren, und nur eine korrupte Elite würde irgendwie stören. Schon melden sich Vertreter ebendieser korrupten Elite zu Wort und wollen auch bei den 99 Prozent dabei sein. Und am Ende kann man jede Maßnahme mit dem gerechten Anliegen solcher Volksbegehren rechtfertigen. Alle sind sich gegen die Korruption einig, Ben Ali und Mubarak folgten Gaddafi und Berlusconi. Sie alle wurden urplötzlich als korrupte Herrscher beschimpft, die mit ihrer Ineffizienz alles freie Wirtschaften zunichte machen würden. Stattdessen herrschen nun bis vor kurzem noch namenlose Bürokraten wie Mario Monti. Wie in Ägypten kann man in Zukunft jede möglicherweise nötige Repression damit rechtfertigen, dass man gegen die Gewalttäter, die radikale Minderheit etc. vorgehen müsse, die die berechtigten Forderungen der 99 Prozent, den Triumph der Demokratie, die neue Führung, die neuesten lebenswichtigen Reformen etc. nicht akzeptieren und die Stabilität durch unverantwortliche Aktionen unterminieren. Im Falle der ausufernden Plünderungen Englands twittert Starkoch Jamie Oliver: „In einigen Ländern randaliert die Jugend für die Freiheit, unsere Jugend randaliert für iPads und Trainingsgeräte“, und fordert, „diese Idioten hart anzufassen“. Die kompakte Majorität beklatscht die schließlich einrückende Polizeiarmee und schließlich nehmen alle einen Besen in die Hand, fegen symbolisch den Bodensatz der Bevölkerung weg. Derweil fordern erste Journalisten den Einsatz der Armee, und Premierminister Cameron kündigt ihn für den Fall weiterer Unruhen an. In dieser Argumentationsfigur wird der konterrevolutionäre Aspekt jeder breiten Massenbewegung für so leere Ziele wie Demokratie, Reformen, Freiheit deutlich. Die an ihnen beteiligten Zuschauer sind genau das Material, das man braucht, ergeben noch in der Überflüssigkeit. Dagegen zerreißen die Ausschreitungen in England den Schleier des sozialen Friedens, stellen effektiv alle liebgewordenen Rollen infrage, so dass jeder angeregt wird, über seine Rolle bei den künftigen Konflikten nachzudenken.
Karl Rauschenbach