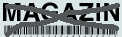Zwischenzeiten I
Anicus Manlius Torquatus Severinus Boethius stand auf der Grenze zwischen den Zeitaltern. Er wußte, daß die Welt, in der er aufwuchs, dem Untergang geweiht war und daß die heraufziehende neue Welt nicht die seine sein würde. Aus dem Hause der Anicier, einer altehrwürdigen römischen Senatorenfamilie, war er einer der letzten in der langen Reihe derer, die ihre Bildung in der platonischen Akademie zu Athen empfingen, bevor diese im Jahre 529 vom christlichen Kaiser Justinian geschlossen wurde. In Ravenna regierte der Gote Theoderich, einer jener germanischen Heerführer in römischem Dienst, die in der Spätantike immer mächtiger und unabhängiger geworden waren. Offiziell war er vom Kaiser zu Byzanz zum Statthalter über Italien berufen, de facto herrschte er aus eigener Machtvollkommenheit. Theoderichs Königtum war von merkwürdiger Zwittergestalt; das Heer wurde von gotischen Kriegern gestellt, aber die zivile Verwaltung war nach wie vor römisch.
Boethius, jeder Romantik abhold, versucht sich den neuen Gegebenheiten anzupassen und als Vermittler zu wirken. Seine erste mittlerische Tätigkeit war die des Übersetzers. Angesichts des Zerfalls des römischen Universalreichs, der den regelmäßigen Austausch zwischen dem griechischsprachigen Osten und dem lateinischen Westen nicht länger gesichert erscheinen ließ, war dies eine notwendige Arbeit, um den Zentralbestand der griechischen Philosophie für das Abendland zu erhalten. „Ich werde jedes Buch des Aristoteles, das mir nur in die Hände kommt, und sämtliche Dialoge Platons ins Lateinische übertragen“, so sein ehrgeiziges Projekt, das, wenngleich unvollendet, Epoche machen sollte. Wenn wir heute „Subjekt“ sagen, oder auch „Spekulation“, „definieren“ oder „Prinzip“, gebrauchen wir Worte, die von Boethius geprägt wurden. Er verknüpfte diese alten lateinischen Begriffe mit einem griechisch-philosophischen Sinn und gab ihnen so eine neue Bedeutung.
Der zweite Vermittlungsversuch des Boethius fand in der Sphäre der Politik statt. Als Berater am Hofe bemühte er sich, das fragile Gleichgewicht zwischen den widersprüchlichen Elementen zu erhalten, auf denen die Herrschaft Theoderichs beruhte, die dem gebeutelten Italien inmitten der Wirren für einige Jahrzehnte Frieden gebracht hatte. Ein Geschäft, das auf die Länge schwer gut gehen konnte: Goten und Römer brauchten einander zwar, aber sie mißtrauten sich zutiefst. So war es absehbar, daß die Situation sich über kurz oder lang nach einer Seite hin auflösen würde: entweder Restauration der römischen Herrschaft oder Germanentum sans phrase. Nicht schwer auszudenken, mit welcher Lösung Boethius sympathisierte. Im Jahre 523 wurde gegen ihn der keineswegs unplausible Vorwurf der Konspiration mit Byzanz gegen Theoderich erhoben. Nachdem ihn seine Senatskollegen und mutmaßlichen Mitverschwörer in Rom im Stich gelassen hatten, verurteilte ihn der König zum Tode.
Im Kerker auf seine Hinrichtung wartend, schrieb er das Buch Consolatio Philosophiae – Trost der Philosophie. In diesem erscheint Philosophia in Gestalt einer schönen Dame in der Zelle des Verdammten, um seine Tränen zu trocknen und seinem aufgewühlten Geist Frieden zu schenken. Nicht klagen solle er über den Verlust weltlicher Güter wie Reichtum, Ehre und Macht, denn diese seien unbeständig und gewährten doch nur einen scheinhaften Genuß. Nicht nach Äußerem solle der Mensch streben, um Befriedigung zu finden, sondern besinnen müsse er sich auf sich selbst. Im eigenen Inneren, im Wissen um ihre einzigartige Fähigkeit zur Reflexion, finde die menschliche Seele ihren wahren Schatz und wirklichen Schmuck, der sie der Gottheit selbst ähnlich mache. Gerade in der Fähigkeit, von allem Konkreten, Materiellen zu abstrahieren und sich in andere Sphären aufzuschwingen, erkennt Boethius angesichts des verworfenen Weltzustands die Freiheit des menschlichen Geistes. In dieser Untergangsepoche, als der reale Handlungsspielraum des Individuums zusammenschrumpfte, fand dieses, durch Wendung der Reflexion auf sich selbst, zu einem deutlichen Bewußtsein seines Wesens und seiner potentiellen Macht. In Boethius’ Werk findet sich die erste Definition von „Person“ in der philosophischen Literatur: „Person ist die individuelle Substanz einer vernunftbegabten Natur“.
Während Boethius nichts blieb, als seinen Untergang zu verklären, ging Cassiodor, sein Amtskollege an Theoderichs Hof, einen Schritt weiter. Zunächst zeichnete er sich durch mehr diplomatisches Geschick aus: Nachdem Boethius hingerichtet worden war, hielt er eine offizielle Lobrede auf dessen Ankläger. Trotzdem blieb er dem gemeinsam begonnenen Werk treu. Sein Beitrag zur Vermittlung des Alten mit dem Neuen blieb jedoch nicht mehr auf dem Boden der Antike, es war ein wirklicher Neubeginn. Cassiodor verließ Ravenna und den Königshof, kehrte Welt und Politik den Rücken, um sich in die Abgeschiedenheit Süditaliens zurückzuziehen, wo er das Kloster Vivarium gründete. Mit im Gepäck befand sich seine umfangreiche Privatbibliothek. Und er war es, der in seinem Ordenshaus den mönchischen Brauch des Übersetzens und Abschreibens klassischer Texte begründete. Er erfand so eine organisatorische Form, dank der der Geist in ihm zunehmend feindlichen Zeitläufen überleben konnte – als verschworene Gemeinschaft, die mit der Welt nicht zusammengehen darf und das Besitztum der Wahrheit zu hüten hat. War Boethius der letzte Römer, so war Cassiodor der erste Mann des Mittelalters.