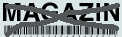Zwischenzeiten III
Im Ausgang des 18. Jahrhunderts kursierten in Deutschland zahlreiche mehr oder weniger aufklärerische Magazine. Es gab u.a. Wielands Teutschen Merkur, später Neuer Teutscher Merkur, Schillers Musenalmanach und Thalia, Biesters und Gedikes Berlinische Monatsschrift, später Berlinische Blätter, dann Neue Berlinische Monatsschrift, Hissmanns Magazin für die Philosophie und ihre Geschichte, Lichtenbergs Magazin für das Neueste aus der Physik und Naturgeschichte, Reichhards revolutionär- demokratische Frankreich und Deutschland, Rebmans Geißel, die revolutionsfeindliche Eudömonia und Hennings Genius der Zeit. Gerade hatten die Franzosen durch ihre Revolution das Gerede von der Humanität des kommenden Zeitalters praktisch widerlegt. Die Deutschen – für eine Revolution meistens untauglich – verlegten sich daher von vornherein auf die Publizistik. Inhaltlich wurde die Szene damals von der Auseinandersetzung zwischen Illuminaten und Rosenkreuzern, bzw. Klassik und Romantik beherrscht. Allerdings traten diese beiden Seiten selten rein für sich auf und die meisten Köpfe waren konfus und innerlich zwischen den beiden nicht besonders bewussten Polen gespalten. Der Konflikt verlief daher meistens quer durch die verschiedenen, durch persönliche Bande zusammengehaltenen Zirkel und es war durchaus möglich, daß der Romantiker Schlegel im Hause Goethes ein- und ausging, oder daß einzelne Personen auch schlicht die Fronten wechselten: Fichte mutierte – nachdem er von der weimarer Illuminatenfraction geschaßt worden war – vom glühenden Vertreter der Vernunft zu einem frühen Vertreter der später sogenannten Hitlerpartei. Auch Herder durchlief solche Schwankungen. Man kann daher nicht sagen, daß diese Zeit für die gegenwärtigen Literaturforscher sehr einfach zu begreifen ist. Dies um so mehr, als der an der Oberfläche erscheinende Konflikt von Revolutionsbefürwortern und Revolutionsablehnern nicht den wirklichen Konflikt zwischen Aufklärung und Aberglauben spiegelt und sich in beiden Parteien jeweils beide Meinungen zu diesem Gegenstand finden.
Selbstverständlich versuchten die bewußten Vertreter der Aufklärung das konfundierte Publikum in ihrer Hinsicht zu vereinen. Den zahlreichen, heterogenen Journalen sollte mit den Horen ein Zentralorgan entgegengesetzt werden. Dies war umso wichtiger, als mit dem Untergang der Illuminaten die Aufklärer ihrer politischen Organisation beraubt waren. Der neuerlichen Dissoziation sollte wieder die Assoziation entgegentreten – und was eignet hierfür besser als zunächst ein Journal. Ziel war es, die vorzüglichsten Schriftsteller der Nation in einem Organ zu sammeln, um so auch das vorher geteilt gewesene Publikum zu vereinen. Insbesondere war der Plan Schillers – welcher das neue Magazin herausgab – „alle Journale, die das Unglück haben, von ähnlichem Inhalt mir den ‚Horen‘ zu sein“, zu Fall bringen. Insbesondere Wielands Merkur – zwar einst ein großartiges Organ der Aufklärung, aber inzwischen etwas fade geworden – sollte verschwinden. Tatsächlich gelang es, zahlreiche Figuren des deutschen Geisteslebens zu sammeln; darunter Herder, Jacobi, Schiller selbst, Goethe, Hölderlin, Wilhelm von Humboldt, Schlegel und Fichte. Indem die Werbung für dieses Organ das bislang auf dem Zeitschriftenmarkt Übliche weit übertraf, gelang es auch, eine ungewöhnlich hohe Auflage von 2300 Exemplaren pro Heft des ersten Jahrgangs unter das Publikum zu bringen. Die Horen vermochten es aber nicht, sich langfristig auf dem Markt zu bewähren. Insbesondere Schillers und Fichtes Stil erschien den Zeitgenossen unleserlich und spekulativ. Wenn auch Schiller versuchte, allein Fichte dem Nimbus des Unverständlichen anzuhängen, um so den Verdacht von sich selbst abzulenken, sank doch die Auflage schnell auf 1000 Exemplare. Die Zeitung wurde schließlich sang und klanglos eingestellt. Da sie selbst nicht als Schauplatz von Entgegnungen auf die zumeist negative Rezeption dienen sollte, veröffentlichten Schiller und Goethe daraufhin im Musenalmanach für das Jahr 1797 zahlreiche Zweizeiler gegen das Publikum, welches dadurch nicht leidlicher wurde; die beiden späteren Säulenheiligen der deutschen Aufklärung galten daher damals recht allgemein als „Sudelköche von Jena und Weimar“. Selbst der alte Illuminat Wieland konnte sich seinen Ärger über die von den beiden Freunden forcierte Spaltung der Gelehrtenrepublik nicht verkneifen.
Allerdings war der Untergang der klassischen Horen kein Sieg der romantischen Gegenseite. Der Gebrüder Schlegels Athenäum währte auch nur drei Jahre. Vielmehr setzte sich in Deutschland die Lethargie des Publikums durch.
In der Gegenwart haben alle Magazine das wahrscheinliche Schicksal, ignoriert zu werden. Den jeweiligen Herausgebern bleibt daher nichts anderes übrig, als zur Kenntnis zu nehmen, daß ihr Produkt zunächst nichts ist als ein aufwendig gemachtes Tagebuch, welches immerhin einem kleinen Kreis zur Verfügung steht. Insbesondere befreundete Menschen werden sich im Zweifel spröde zeigen. Zwar ist es möglich mit Werbung bis zu 2000 Exemplare in Hochglanz zu verbreiten, aber die Erfahrung zeigt, daß diese Publikationen nicht gelesen und noch weniger diskutiert werden. Verbreitet sich eine Schrift nicht von selbst – spricht man über sie also nicht am Küchentisch – so muß sie eingehen. Auf Werbung sollte man daher weitgehend verzichten, wie auf den Glanzdruck und statt dessen besser darauf vertrauen, daß eine Publikation ihre Leserinnen schon von selbst finden wird, wenn sie nur taugt. In seltenen Fällen entpuppt sich eine von den unmittelbaren Zeitgenossen ignorierte Zeitschrift immerhin als nützlich für die Nachgeborenen. Normalerweise liegt die Ignoranz aber an ihrer mangelnden Qualität. Trotzdem muß man darauf achten, daß vernünftige Gedanken von den Zeitgenossen auch deshalb abgelehnt werden, weil sie vernünftig sind.