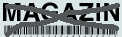Manifest gegen Nicht-Tuer
Kleine Morallehre für den Untergrund, in 5 Aufzügen.
Folgender Vortrag wurde in geänderter Fassung und versehen mit einer Notiz für den internen Handgebrauch in der 55. Ausgabe der „Abwärts“ abgedruckt, der Zeitung des Poetenbezirks Prenzlauer Bergs. Dort wurde er durch eine „Kleine Anleitung zum Faulsein“ von Kai Pohl ergänzt, welche hier nur im PDF dokumentiert ist. Der Vortrag in leicht rückgeänderter Version auch als HTML.
 Scan des Artikels aus der Abwärts
Scan des Artikels aus der Abwärts

Nur für internen Handgebrauch!
Folgender Text wurde für den 13. Kneipengeburtstag der Schankwirtschaft Laidak geschrieben und dort am 11. Februar 2025 in einer Rohfassung vorgetragen. – Seit dem Ende des letzten Ausnahmezustands, mit dem auch die neuköllner Verweigerungsbestrebungen mehr und mehr versandet sind, hat sich auch im Laidak eine ganz eigene Form der Nicht-Tuerei breit gemacht, die zunehmend den Eindruck erweckt, dass es sich hier doch nur um eine kommerzielle Bar handelt.
1. Motto. Zitat Rainald Goetz.
»De Labore – Arbeit macht Arbeit. Dem Gesetz der Tautologie folgend, demzufolge Macht Macht macht, Geld Geld, Glück glücklich, Schwäche schwach, Essen Hunger, Denken Gedanke, macht also auch die Arbeit keineswegs frei, wie eine schöne, alte, böse Torinschrift behauptet, sondern ist Arbeit selbstverständlich nur ein anderer Knast, allerdings der allerschönste Knast. Denn während das Leben im Faulheits-, Antiautoritäts- und Schlamperlebensknast immer trauriger, dümmer, dumpfer, selbstzufriedener macht, macht das Lebens im Arbeitsknast stark, eigen, maßlos, glücklich, unberührbar und gefährlich.«
2. Die Weigerung, die sich selbst setzt
Es stimmt, man soll sich verweigern. Man soll sich staatlichen Schutzmaßnahmen verweigern, man soll sich der Bundestagswahl verweigern, man soll sich wahlweise den linken oder der rechten Faschisten verweigern, man soll sich dem Krieg verweigern, den Bullen, den Chefs, den identitären Reinheits- und Waschzwängen, der Hässlichkeit des Konsums, meinetwegen soll man sich sogar der Lohnarbeit verweigern, wenn man sich es leisten kann – Jedoch bei der Arbeit gelangt die Weigerung an ihr logisches Ende, in der Verweigerung des Tuns schaufelt sich die Weigerung ihr eigenes Grab.
Denn auch die Weigerung will, wie Hegels Widerspruchsgeist, organisiert sein. Organisierte Weigerung nennt sich dann wahlweise radikale Linke, freie Szene, Underground, etc. Hier tummeln sich Individuen, die mehr und anderes wollen als die diversen Programme der offiziellen Massenkultur verheißen, die in der Lage sind, außerhalb des Diktats des Mainstreams eine Gegenwelt zu betreiben. Aber halt! – An dieser Stelle geht in einem Nebenzimmer meines Bewusstseins der Kulturindustrie-Kritiker schon auf die Barrikaden: Durch die Trennung der Sphären setzt sich die allgemeine Logik doch besonders systematisch …
Doch es bleibt dabei: Es gibt eine diffuse Sphäre, die versucht der dumpfen Lebensweise des normal saturierten Kleinbürgers – das heißt heute: auch des durch diese Sphäre der Gegenwelt selbst schon durchgegangenen Kleinbürgers – auszuweichen. Lebenskunst statt Lebenslauf, Autonomie statt Autopilot, der bereits ziemlich alte Traum der Boheme, in der heutigen Variante: Eben kein Praktikant der eigenen Existenz sein wie so viele andere. Selbstverständlich kommt es immer wieder zur Entstehung solcher verrückten Formen. Selbstverständlich sind sie immer davon bedroht, von der ganz großen, verrückten Form wieder aufgefressen zu werden. Ursache und Folge äußerer Integrationsbemühungen sind seit Jahrzehnten hinlänglich bekannt, Beispiele allgegenwärtig.
3. Die unwahrscheinliche Figur des Nicht-Tuers
Weniger thematisch sind hingegen die inneren Triebkräfte des Zerfalls, der Selbstzerstörungsdrang durch zB. übermäßiges Saufen ist hier noch am meisten beredet. Besondere Konjunktur erfreut sich in letzter Zeit aber das Phänomen des Nicht-Tuers. Dieser destruktive Charakter, der nur wegräumt, aber nichts eigenes schafft, ist ein eigentümlicher Ausdruck der widersprüchlichen Selbstkonstitution des Undergrounds und so alt wie dieser. Er vermehrt sich jedoch diametral entgegengesetzt zum schleichenden Niedergang der herrschenden Kapital-Kultur: Je maroder diese an jeder Ecke, desto organischer greift die Nicht-Tuerei in Bohemia um sich.
Die Spezies des Nicht-Tuers ist dabei keinesfalls zu verwechseln mit der des Nichtstuers. Der Nichtstuer, von bürgerlichen Sozialchauvinisten gerne auch als »Nichtsnutz« attribuiert, hat sich wortwörtlich fürs Nichts-tun entscheiden, verbleibt also willentlich in der omnipräsenten Dumpfheit einer nicht-autonomen Lebensweise. Anders als dieser tut der Nicht-Tuer aber ja nicht nichts, er tut sehr wohl etwas, denn immerhin hat er den ersten Schritt aus den geleiteten und vorgezeichneten Bahnen getan. Vielleicht ist er in einer (Kollektiv-)Kneipe gestrandet, in einem Hausprojekt oder einer Zeitschrift. Vielleicht hat er mal irgendeine Kunst gemacht, sich mit irgendeiner politischen Tat hervor getan. Jedenfalls bewegt er sich, im Unterschied zum Nichtstuer irgendwie in den Gefilden der Gegenwelt.
Der Nicht-Tuer ist also nicht einfach untätig, er verpasst nur andauernd, das Entscheidende zu tun. Seine Haltung ist meist von einer übermäßigen Vorsicht und Mutlosigkeit geprägt. Ihm fehlt ist Kairos, ist Chuzpe. Seine Umwelt, die die leicht zu erkennende Bestimmung hat, der abgrundtiefen Langeweile der standardisierten Kommerz-Umwelt zu entfliehen, nimmt er für selbstverständlich hin.
Der Nicht-Tuer hat nicht erkannt, dass die Indifferenz gegenüber dem Außen, innerhalb des Offiziellen die größte Tugend, nun, im Nicht-Offiziellen, der größte Hinderungsgrund ist. Der Nicht-Tuer versteht nicht, dass seine Weigerung organisiert werden will und verhält sich daher als zuschauender Konsument innerhalb der organisierten Weigerung, die doch bloß den Zweck hat, aus dem Dasein als zuschauender Konsument herauszuführen. Kurz: Weil der Nicht-Tuer sich nicht bewegt, spürt er die Bedingungen seines Ketterauchens nicht.
Deswegen ist logisch der Nicht-Tuer ein klares Produkt von Nicht-mit-Denken. Das Nicht-Tuen kann hier und anderswo natürlich nur der Denkfaulheit und Analyseverweigerung entspringen. Das Nicht-mit-Denken wiederum rührt von einem viel tieferen Wahrnehmungsversagen her, das heute systematischer noch als in allen vorherigen Epochen produziert wird. Um diese Tatsache zu beweisen genügen zwei Stationen in der nächstgelegenen U-Bahn: Smarte Maschine entwöhnen gründlich von der Fähigkeit der Wahrnehmung der nächstliegenden Umgebung.
Ohne ein selbstverständliches Mit-Denken im Sinne einer Antizipation der notwendigen Selbsterhaltungs- und Entwicklungsschritte ist die Gegenwelt dem Untergang geweiht. Ohne die ständige analytische Voraussicht, der erfahrungsmäßigen Deutung des Alltages, wo gibt es wann welchen anstehenden Hand- oder Kopfgriff zu tun, wird die autonome Organisation der Weigerung wieder ein unfreies, weil nicht-gedachtes sich-Leiten-lassen durch ein von eben vorgegebenes Programm.
Nach einem solchen Dienst nach Vorschrift sehnt sich der Nicht-Tuer insgeheim, ohne es zugeben zu können: Er will sich keiner Sache voll annehmen, er will nicht kämpfen, er mag sich bloß verkriechen vor dem Leistungsdruck in einer Nische, die er dann kaum fähig ist, auszuhalten oder gar mitzubetreiben. Der Nicht-Tuer hat sich in die Welt ohne Chefs bewegt, beweist aber mit jedem Akt der Nicht-Tuens, dass er nicht sein eigener Chef sein möchte. Die Existenz des Nicht-Tuers ist deshalb unwahrscheinlich, weil unlogisch: Er klagt das Recht auf Nicht-Tuen ein, schottet sich aber davon ab, dass sein Nicht-Tuen nur durch das Tun anderer ermöglicht wird.
Den Nicht-Tuer darf man sich dabei keineswegs so vorstellen, wie der dumme Kritiker des Antisemitismus den Antisemiten: Hier der Böse, ich daher gut. Vielmehr ist der Nicht-Tuer dem zu vergleichen, was die Vulgär- und Küchenpsychologie als den »inneren Schweinehund« kennt. Was wir bekämpfen müssen, ist nicht der äußere, sondern der innere Nicht-Tuer in jedem von uns.
4. Die scheinbar nebensächliche Frage danach, wer die Scheiße wegmacht
Im Innenhof meines Wohnhauses liegt seit zwei Wochen ein Haufen Scheiße. Mit einem Papiertaschentuch als i-Tüpfelchen hübsch garniert. Jeden Tag gehe ich daran vorbei, gehen hunderte von Menschen daran vorbei. – Nichts gegen Menschen, die keinen Ort zum scheißen haben. Aber: Wer macht die Scheiße weg? Niemand macht die Scheiße weg.
Macht es etwa der Hausmeister, der nie da ist? Die Heerscharen an verdaddelten Sprachschülern, die genau diesen Haufen Scheiße für eine »authentic experience« des wilden Berlins halten? Der Betreiber der Sprachschule, der vielleicht genau darauf spekuliert? Die anderen Hausbewohner, die unzähligen halbversklavten Amazon-Paket-Boten? Die Imbiss-Mitarbeiter, die beim Anblick der Scheiße heimlich am Hinterausgang ihre Joints rauchen? Nein, niemand macht die Scheiße weg.
Die Scheiße in meinem Innenhof ist mittlerweile in sich zusammengesackt und schimmelt. Nein, auch ich bin kein wackerer Bürger, der seinen Kiez sauber hält, auch ich starre die Scheiße nur an, auch ich mache die Scheiße nicht weg. So bleibt es dabei: Niemand macht die Scheiße weg.
Denn das ist der Punkt mit der Scheiße, jemand muss sie am Ende doch wegmachen. Und solange wir nicht die Frage zu allseitiger Befriedung geklärt haben, wer die Scheiße wegmacht, brauchen wir gar nicht weiterreden. Solange bleibt nämlich jedes »Je suis anarchiste« eine Verleugnung der eigen Freiheit; solange bleibt jeder proklamierte »Kommunismus« eine fade gedankliche Wichserei. Solange bleibt die Weigerung unorganisiert.
Solange nämlich die Frage nicht geklärt ist, wer die Scheiße wegmacht, hat sich jede freie Szene, jedes Kollektiv oder Nicht-Kollektiv, jede Assoziation, die sich »menschlicher« dünkt als der Rest, sich schon selbst in die Eier getreten: Wie ich in meinem Innenhof die Scheiße, so glotzen sich alle im Kreis gegenseitig an, jeden Tag drei mal. Niemand ist verantwortlich und die Scheiße bleibt, wo sie ist. Das ist die Pornographie des Nicht-Tuers, der Fetisch, seinen eigenen Status als Zuschauer zu begaffen.
5. Der Appell, die Arbeit zu sehen
Kontrolle Philosophie: Schulen- und traditionsübergreifend spricht die Philosophie von der Arbeit als Mittelpunkt der Welt. Hegels Knecht bearbeitet die Sache, wo der Herr nur genießt: Am Ende erweist sich die Herrschaft des Genießen, abgeschnitten vom Tun, als das eigentliche »knechtsche Bewusstsein«. Schaut man auf der anderen Seite nach, so finden wir auch wir bei Heidegger die zentrale Stellung des Arbeit: im zuhandenden Zeugs, das die Umwelt des Daseins konstituiert. Nirgendwo sonst stimmen Dialektik und Ontologie so sehr überein.
Doch genauso logisch wie diese Einsichten ihren Weg vom gesunden oder ungesunden Menschenverstand ins Zentrum großer Philosophie gefunden haben, genauso logisch werden sie praktischen jeden Tag wieder vergessen und von einer schwer bestimmbaren Schwerkraft aus der gewussten Taghelle der Gegenwelt wieder ins Dunkle des Spektakels hinab gezogen.
Es sei daher hier die Gelegenheit genutzt, einen eigentlich unmöglichen Sprechakt zu begehen und das Nicht-Tun zurückzuweisen. Unmöglich deshalb, weil es ja aus dem voran gegangenen natürlich keine Kritik des Nicht-Tuens geben kann, weil man mit dieser Kritik den Chef wieder einführt, in dessen Ausschluss ja gerade die Gegenwelt gründet. Trotzdem also, und weil die Kritik des Nicht-Tuns nicht zu leisten seinerseits dem Verdikt des Nicht-Tuns verfallen wäre, sei hier ein erstes und letztes Mal – in der Sprache des Manifests – festgehalten:
Es gibt kein Recht auf Faulheit. Es gibt kein gutes Leben im »Faulheits-, Antiautoritäts- und Schlamperlebensknast«. Es gibt kein faire rien comme une bête: Auf dem Wasser liegen und friedlich in den Himmel schauen, das war schon immer unaushaltbar, das war schon immer die verkitschte Phantasie der 40er Jahre, seit der Zeit also da es auch für die Mittelklassen in Amerika schick wurde, sich an den Strand zu legen und angeblich nichts zu tun, wie sie auch sonst in ihrem Leben meist nichts, und wenn dann nichts handfestes, tun.
Was es außerdem nicht gibt, sind faule Ausreden: Ich habe keine Zeit, ich bin depressiv. Man muss so leben wollen, dass man sich die Zeit nehmen kann. Und das Nicht-Tun verursacht erst oder verschlimmert meinetwegen die Depression.
Was es dagegen gibt, sind eine Handvoll Volksweisheiten, die leider alle wahr sind: Das Glück ist mit den Tüchtigen; wer macht, hat Recht; nichts gutes, außer man tut es. Vor allem: Arbeit sehen.
Was es gibt, sind Leute, die vernünftige Dinge machen, die sich einzubringen wissen, die verstehend die Welt bearbeiten, auf dass sie vor ihnen und ihren Mitgeschöpfen ein kleines bisschen weniger fremd steht. Und explizit ist damit die ganze Totalität der Lebenswelt gemeint, die von den sozialen Beziehungen über inhaltliche Positionsbestimmung bis zur ästhetischen Gestaltung von Zeit und Raum reichen.
Was es gibt, ist der unausgesprochene und aussprechbare Konsens der Gegenwelt, nicht nicht zu tun. Was es am Ende gibt, das sind Kunst, Musik, Politik, Literatur, Freundschaft, Liebe.
Wir brauchen deshalb keine Macher, auch die übelsten Sklaventreiber von Bill Gates bis Christian Lindner sind immer Macher, sind immer Scharfmacher gewesen. Der Typus des Machers verbleibt innerhalb der Typologie des Zuschauers und eine abstrakte Negation der Nicht-Tuerei genauso wie seine zahlreichen Abkömmlinge in Form von hysterischer bis aufgeregter Überbekümmertheit.
Es geht auch nicht ums Projekte-Machen, nicht um Aktivismus, um kein Hamsterrad der Betriebsamkeit. Nicht das Quantum zählt, sondern die grundlegend durch Offenheit signalisierte Bereitschaft, zur richtigen Zeit das richtige Schräubchen drehen zu können. Da sein, wenn es drauf an kommt. Aber lieber einmal zu viel, als einmal zu wenig. Und mit möglichst langem Atem.
Dabei weiß jeder selbst am Besten selbst, wo er sinnvollerweise anpacken kann, Handlungsbedarf ist unendlich vorhanden, Gelegenheiten zur beherzten Intervention ergeben sich laufend, Beispiele wären hier nur hinderlich.
Jeder nach seinen Fähigkeiten, jeder nach seinen Bedürfnissen, hinter diesen Satz geht nichts zurück. Nur die Mutlosigkeit muss man ablegen, sich weder von der eigenen Einschüchterung noch von der der anderen dumm machen lassen. –
Unserer Weigerung ist total oder sie ist nicht: Denn solange wir mit dieser verhunzten und entstellten Gesellschaft auskommen müssen, braucht es eine Gegensphäre. In ihr aber gibt es nichts selbstverständliches, alle Dinge, die hier da sind, sind von irgendjemanden von uns gemacht, und zwar aus freien Stücken.
Wie wenig selbstverständlich uns die uns umgebende Welt sein sollte, wird besonders augenfällig in Zeiten der Krise, wenn wir merken müssen, dass die Infrastruktur, die wir nutzten, uns am Ende nicht gehört und ergo wir durch ihren Entzug erpressbar sind. Worin aber nur der nächste Grund liegen kann, die Weigerung zu konsequent zu organisieren, möglichst weitgehend eigene Räume aufzubauen und sich das Terrain des Tuns wieder anzueignen.
Andernfalls, und das lehrt das Beispiel mit der Scheiße in meinem Innenhof, die nämlich doch irgendwann scheinbar von selbst verschwindet und bloß noch das verschmierte Taschentuch auf braun verwelkten Umriss zurückbleibt: Andernfalls übernehmen die Ratten – oder, nehmen wir auch diesen Vorgang als Metapher: übernehmen Récupérateure das Terrain – und das schneller, als man denkt.
11. Feburar 2025